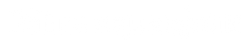Wie das Verfahren funktioniert und warum es die Teil- und Vollentsalzung abgelöst hat
Text & Fotos: BERND KAUFMANN
Um die in der Aquaristik häufig verwendete Umkehrosmose zu verstehen, sollte man zuerst wissen, was Osmose ist. Sie begegnet uns im täglichen Leben ständig. Bei der Osmose „wandert“ Wasser von der geringeren zu einer höheren Konzentration – durch eine halbdurchlässige (semipermeable) Membran. Das geschieht so lange, bis der sogenannte osmotische Druck im Gleichgewicht ist.
Im klassischen Versuch wird ein Glasrohr, das unten mit einer Membran verschlossen ist, teilweise mit Zuckerlösung gefüllt. Dann wird das Rohr in einen Behälter mit reinem Wasser eingetaucht. Nun wandern Wassermoleküle durch die Membran, und man sieht, wie der Wasserspiegel im Rohr steigt. Der Vorgang läuft so lange, bis im Rohr die Zahl der eingedrungenen Wassermoleküle der Zahl der Zuckermoleküle entspricht. Die Lösung ist dann im Gleichgewicht.

Reife Kirschen mit hohem Zuckergehalt platzen nach heftigem Regen, weil Wasser eindringt, um den Zuckergehalt zu verdünnen.
Eine alltägliche Beobachtung zeigt den gleichen Vorgang in der Realität: Reife Kirschen platzen auf, wenn nach einem starken Regen eingedrungenes Wasser den Druck im Inneren der Kirschen erhöht.
Durch den prinzipiell gleichen Vorgang verlieren Meerwasserfische ständig Wasser aus ihren Zellen, das „versucht“, mit dem umgebenden Meerwasser ein Konzentrationsgleichgewicht zu erreichen. Marine Fische müssen also diesen Verlust durch ständiges Trinken ausgleichen. Sie scheiden das dabei aufgenommene überschüssige Salz über die Kiemen wieder aus.
Süßwasserfische müssen mit dem umgekehrten Problem fertig werden: Sie nehmen ständig aus dem geringer konzentrierten Süßwasser Wassermoleküle auf, welche den Drang haben, die höher konzentrierte Lösung in den Zellen zu verdünnen. Süßwasserfische scheiden deshalb große Mengen überschüssiges Wasser als stark verdünnten Urin wieder aus.

Die ursprüngliche Leitfähigkeit von 543 μS/cm im Leitungswasser wurde auf 24,2 μS/cm gesenkt.
Umkehrosmose
Wie der Name sagt, wird bei der Umkehrosmose die Osmose umgekehrt. Unter dem Leitungsdruck wird das Wasser entgegen der normalen Richtung durch die Membran gepresst. Die Membran kann man sich vereinfacht auch als extrem feines Sieb vorstellen, das nur reines Wasser passieren lässt und größere Teilchen weitgehend zurückhält.
Das erzeugte Reinwasser (Permeat) enthält nur noch sehr geringe Restbestandteile der ursprünglich im Leitungswasser enthaltenen Stoffe. Karbonathärte, Gesamthärte,
Wasserbelastungen wie Nitrat, Phosphat, Pestizide, Schwermetalle, aber auch Spurenelemente werden zu 90 bis 98 % entfernt. Die elektrische Leitfähigkeit sinkt deutlich unter 10 % des ursprünglichen Wertes.

Das Herzstück der Umkehrosmoseanlage, die Membran.
Mit einer entsprechenden Menge Leitungswasser zur Aufhärtung, oder mit der Zugabe einer geeigneten Mineralsalzmischung, kann so jedes gewünschte Aquarienwasser hergestellt werden.
Das Verhältnis Reinwasser (Permeat) zu Restwasser (Konzentrat) beträgt dabei 1:4. Dies erscheint sehr ungünstig. Berechnungen zeigen aber, dass ein Liter Reinwasser im Durchschnitt nur 2 bis 3 Cent kostet. Bei Anlagen mit sogenannten Druckerhöhungspumpen lässt sich auch ein Verhältnis von 1:1 erreichen. Diese Geräte sind allerdings erheblich teurer in der Anschaffung.

Meerwasserfische trinken aktiv, um den osmotischen Druck aufrechtzuerhalten.

Süßwasserfische dagegen trinken kein Wasser.
Mit der Umkehrosmose steht ein modernes, umweltfreundliches und sehr einfaches Verfahren der optimalen Wasseraufbereitung zur Verfügung. Artgerechtes Wasser für alle Zierfische und Wasserpflanzen kann somit individuell ohne großen Aufwand und preiswert hergestellt werden. Die Umkehrosmose hat in der Aquaristik die Wasseraufbereitung mit Teil- und Vollentsalzung (Ionenaustauscher) weitgehend abgelöst, denn das lästige und aufwändige Regenerieren mit Salzsäure und Natronlauge entfällt bei der Umkehrosmose komplett.
Wasser sparen
Ein erheblicher Teil des Wasserverbrauchs bei einer gut gewarteten Umkehrosmoseanlage geht auf das Konto der Membranspülung. Alle Hersteller empfehlen mehr oder weniger lange und häufige Spülungen als wichtigste Wartungsarbeit für ihre Anlagen.
Es gibt jedoch eine Möglichkeit, diese normalerweise sinnvollen Spülvorgänge auf ein absolutes Minimum zu reduzieren, ohne der wertvollen Membran zu schaden. Das funktioniert recht einfach:
- Nach dem normalen Einsatz der Anlage lässt man noch etwa einen Liter Permeat (Reinwasser) produzieren, das man in einen separaten Behälter laufen lässt.
- In diesem Reinwasser bleibt der Permeat-Schlauch, der fixiert wird, damit keine Luft eindringen kann. Dieser Punkt ist sehr wichtig (siehe Bild, Becherglas links, weißer Schlauch).
- Den Abwasserschlauch belässt man an seiner normalen Position. Will man die Vorgänge kontrollieren und überprüfen, kann man die im Bild gezeigte Versuchsanordnung nachbauen.
- Nun wird der Zulauf (Wasserhahn) geschlossen und die Schläuche bleiben in ihrer Position. Jetzt dringt Permeat in der umgekehrten Richtung wieder in das Membranmodul ein und erhöht den Druck auf der Konzentratseite, sodass Konzentrat abfließt, bis es innerhalb der Anlage zum Ausgleich der Konzentrationsunterschiede kommt.

Links das Becherglas mit dem Reinwasser (16 μS/cm), rechts das (bereits verdünnte) Konzentrat 427 μS/cm.
Auf diese Weise kann es kaum zur gefürchteten Verblockung durch Bildung von Kalkablagerungen kommen. Sicherheitshalber sollte ab und zu dennoch kurz gespült werden, um einer Verkeimung und der Ablagerung anderer Partikel auf der Membran vorzubeugen. Diese Spülvorgänge können dann allerdings sehr kurz sein. Insgesamt spart man einen Großteil des Spülwassers, und wahrscheinlich ist bei dieser Methode eine Verblockung der Membran fast ausgeschlossen.
Die Vorgänge lassen sich am einfachsten mit der Messung der elektrischen Leitfähigkeit beschreiben. Zum Zeitpunkt der Aufnahme wurden mit unserer Anlage (Dennerle Osmose 190 Professional) folgende Messwerte ermittelt:
- Rohwasser (Leitungswasser) 535 μS/cm
- Permeat (Reinwasser) 16 μS/cm (linkes Becherglas)
- Konzentrat (Abwasser) 762 μS/cm
- Konzentrat (Abwasser) 427 μS/cm (rechtes Becherglas, bereits durch Reinwasser verdünnt)

Eine einfache und preiswerte Umkehrosmoseanlage.
Wir wenden diese Methode seit ca. zwei Jahren ohne erkennbare Nachteile unter den hier herrschenden Rahmenbedingungen an und haben die Dokumentation mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch müssen wir jegliche Haftung für eventuelle Schäden ausschließen.